Mehr Daten, bessere Entscheidungen? Gerade in Zeiten von Big Data und Künstlicher Intelligenz erscheint diese Annahme plausibel – doch die Autoren zeigen, warum sie trügerisch sein kann. In Smart Management stellen sie die gängige Managementweisheit radikal infrage. Sie argumentieren, dass komplexe Analysen nicht immer überlegen sind – und dass einfache Entscheidungsregeln, sogenannte Heuristiken, in vielen Situationen sogar die bessere Wahl sein können.
Alle drei Autoren zählen zu den international renommierten Entscheidungsforschern: Jochen Reb ist Professor für Organisationsverhalten und Personalwesen an der Singapore Management University. Shenghua Luan ist Professor für Psychologie an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking. Gerd Gigerenzer ist emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und leitet heute das Harding-Zentrum für Risikokompetenz an der Universität Potsdam.
Das Werk ist in drei Teile gegliedert: Zunächst erläutern die Autoren, welche Defizite sie in den einschlägigen Business Schools beim Thema rationale Entscheidungsfindung sehen. Sie erklären anschließend, warum Heuristiken nützlich sind, und stellen dann einen „adaptiven Werkzeugkasten“ mit Entscheidungsregeln vor. Im zweiten Teil wird gezeigt, wie diese im Management Anwendung finden – etwa in Personalfragen, Führung, Innovation, Verhandlung oder Strategie. Der dritte Teil widmet sich Intuition, der Rolle von KI und der Frage, wie eine Kultur kluger Entscheidungen entwickelt werden kann.
Heuristiken: einfache, aber effektive Entscheidungsstrategien
Bevor die Autoren praktische Heuristiken vorstellen, machen sie eine grundlegende Unterscheidung, die auf Leonard J. Savage zurückgeht, einen US-amerikanischen Statistiker und Begründer der subjektiven Entscheidungstheorie. Savage unterschied zwischen „kleinen“ und „großen Welten“, um die Grenzen klassischer Modelle aufzuzeigen. Kleine Welten sind vollständig berechenbar: Alle Handlungsoptionen, Konsequenzen und Wahrscheinlichkeiten sind bekannt – wie beim Roulettespiel. In solchen Kontexten funktionieren komplexe Berechnungen und die erwartete Nutzenmaximierung gut. Große Welten hingegen sind von Ungewissheit geprägt: Nicht alle Zustände sind bekannt, Wahrscheinlichkeiten lassen sich nicht zuverlässig angeben, und neue Ereignisse können jederzeit auftreten. Genau hier setzen die Autoren an: In großen Welten – im Management oft mit VUCA (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität) umschrieben – stoßen klassische Modelle wie die Erwartungsnutzentheorie an ihre Grenzen. Heuristiken können in solchen Kontexten eine robuste und praktikable Alternative bieten – vor allem dann, wenn sie an die jeweilige Umwelt angepasst sind, ein Prinzip, das die Autoren als „ökologische Rationalität“ bezeichnen.
Mehr Nachdenken bringt keine besseren Entscheidungen
Ein zentrales Argument der Autoren lautet: Schnelle Entscheidungen können in bestimmten Kontexten präziser sein als langsame. Damit widersprechen sie der Theorie von Daniel Kahneman und Amos Tversky, die das Denken in zwei Systeme unterteilten: System 1 (schnell, heuristisch, unbewusst) gilt als fehleranfällig, System 2 (langsam, logisch, bewusst) als überlegen. Diese Annahme basiert vor allem auf Untersuchungen in klar strukturierten Risikosituationen, in denen analytisches Denken Verzerrungen korrigieren kann. Gigerenzer und seine Mitautoren argumentieren dagegen, dass diese Logik in einer ungewissen Welt nicht greift: Wenn Wahrscheinlichkeiten unbekannt und Informationen unvollständig sind, führt mehr Nachdenken oder das Sammeln zusätzlicher Daten nicht zwingend zu besseren Entscheidungen. Im Gegenteil – in solchen Kontexten können einfache, schnelle und sparsame Heuristiken robuster und oft auch genauer sein als komplexe Analysen.
Der adaptive Werkzeugkasten
Mit dem „adaptiven Werkzeugkasten“ präsentieren die Autoren ein praxisorientiertes Kernkonzept: eine Sammlung von Heuristiken, die je nach Situation flexibel eingesetzt werden können. Die Autoren betonen, dass solche Regeln nicht nur schneller und einfacher sind, sondern auch transparenter und leichter vermittelbar – ein entscheidender Vorteil gegenüber komplexen Analysemodellen.
Ein oft zitiertes Beispiel ist die Elon Musk zugeschriebene Regel aus den Anfangsjahren von Tesla: „Biete Bewerbenden eine Stelle an, wenn sie eine außergewöhnliche Fähigkeit besitzen, andernfalls nicht.“
Diese Regel klingt bestechend einfach, ist aber nur in engen Kontexten tragfähig – etwa wenn eine Position stark von einer einzelnen Spitzenkompetenz abhängt und grundlegende Anforderungen wie Integrität oder Teamfähigkeit bereits gesichert sind. Berichten zufolge fragte Musk in Interviews zudem: „Erzählen Sie mir von den schwierigsten Problemen, an denen Sie gearbeitet haben und wie Sie sie gelöst haben.“ Durch detailliertes Nachhaken reduzierte er die Wahrscheinlichkeit von Täuschungen.
Abseits solcher Bedingungen ist die Heuristik jedoch riskant: Sie blendet erfolgskritische Merkmale wie soziale Kompetenz, Anpassungsfähigkeit oder kulturelle Passung aus. Zudem können sich Jobanforderungen ändern, sodass eine isolierte Fähigkeit nicht mehr genügt. Forschung zur Personalauswahl zeigt daher, dass valide Diagnostik mehrere Merkmale mit unterschiedlichen Methoden erfassen muss. Strukturierte Interviews, Intelligenztests und Arbeitsproben gelten hier als verlässliche Verfahren.
Ein weiteres Beispiel für eine Heuristik aus dem adaptiven Werkzeugkasten ist die „one good reason“-Strategie: Oft ist das Urteil einer sehr guten Informationsquelle wertvoller als mehrere schwächere Einschätzungen zusammen. Im Bereich Personalentscheidungen zeigt sich das daran, dass mehr Interviewer im Recruitingprozess nicht automatisch bessere Ergebnisse liefern.
Angenommen, ein Interviewer identifiziert acht von zehn geeigneten Kandidaten (Trefferquote: 80 Prozent), ein zweiter kommt auf sechs von zehn (60 Prozent). Entscheidet man sich nur für die Kandidaten, die von beiden positiv bewertet werden, reduziert sich die Auswahl auf sechs von zehn. Der zweite Interviewer erweist sich damit als entbehrlich – sein zusätzlicher Beitrag mindert die Entscheidungsqualität sogar.
Entscheidend ist daher nicht die Anzahl der Interviewer, sondern deren Qualität und die Entwicklung ökologisch rationaler Heuristiken. Wer in hochqualifizierte Interviewführung investiert – basierend auf standardisierten und vergleichbaren Verfahren – erzielt verlässlichere Ergebnisse als mit zusätzlichen Bewertungen, die keinen echten Qualitätsgewinn bringen. Gerade im Bereich Personalentscheidungen zeigt sich jedoch eine Forschungslücke: Viele Heuristiken wirken theoretisch plausibel, doch empirische Belege fehlen weitgehend. Vorhandene Studien stammen überwiegend aus anderen Feldern wie der medizinischen Diagnostik. Auf die Eignungsdiagnostik übertragen, fehlen vergleichbare Evidenzen bisher.
Innovation, Teams und Führung
Die Autoren fragen, warum große Organisationen ihre Innovationskraft verlieren. Sie nennen drei Gründe: Erstens eine negative Fehlerkultur, in der Fehler vermieden statt als Lernchance genutzt werden. Zweitens defensive Entscheidungen, bei denen Manager risikoärmere Optionen wählen, übermäßig dokumentieren und Prozesse absichern. Drittens fehlt häufig die „kreative Zerstörung“ im Sinne von Joseph Schumpeter: Ohne den Mut, Strukturen aufzubrechen und Erfolgreiches infrage zu stellen, stagniert Innovation.
So erklärt sich, warum viele ehemals innovative Start-ups ab einer gewissen Größe an Dynamik verlieren. Als Beispiel nennen die Autoren Innovationsheuristiken wie die 15-Prozent-Regel, die vorsieht, dass Mitarbeitende einen Teil ihrer Arbeitszeit für eigene Projekte nutzen. Bei Google waren es sogar 20 Prozent, woraus unter anderem Gmail und Google News entstanden. Solche Ansätze schaffen Freiräume für Kreativität und können die Innovationskraft langfristig stärken.
Auch beim Thema Teamarbeit liefern die Autoren prägnante Beispiele. Das schon etwas ältere Google-Projekt „Aristotle“ sammelte riesige Datenmengen zu Persönlichkeiten, Kompetenzen und Hintergründen – doch ein klares Muster für erfolgreiche Teams ließ sich nicht finden. Erst eine Studie in Science zeigte: Entscheidend sind zwei einfache Prinzipien. Erstens Empathie – Teammitglieder nehmen die Gefühle anderer wahr und können sich auf sie einstellen. Zweitens gleichmäßige Redeanteile: Wer dominiert, hemmt das Team, wer kaum spricht, verliert Anschluss. Diese einfache Kommunikationsheuristik fördert Balance und Zusammenhalt – und steigert nachweislich die Leistung. Google bestätigte beide Faktoren in einer erneuten Datenanalyse. Das Beispiel verdeutlicht, dass manchmal gerade einfache Regeln den Unterschied zwischen mittelmäßigen und exzellenten Teams ausmachen.
Intuition, Fehlerkultur und KI
Im dritten Teil widmen sich die Autoren dem Thema Intuition, die sie auch als „unbewusste Intelligenz“ bezeichnen. Intuition hat drei Merkmale: Sie beruht auf Erfahrung, tritt spontan ins Bewusstsein und bleibt in ihrer Ursache unbewusst. Damit zeigen die Autoren, dass Intuition keineswegs nur ein bloßes „Gefühl“ ist, sondern oft auf implizit erworbenem Wissen basiert.
Gleichzeitig betonen sie, dass Intuition nicht unkritisch als Bauchgefühl glorifiziert werden darf. Ein reflektierter Umgang ist notwendig: Intuition ist nur dann hilfreich, wenn sie auf relevanter Erfahrung gründet. In der Praxis mangelt es weniger an Intuition, sondern häufiger an methodischer Fundierung, etwa an validen Verfahren zur Personalauswahl. Besonders deutlich wird das in der Eignungsdiagnostik: Wer Entscheidungen ausschließlich auf Bauchgefühl stützt, riskiert systematische Fehler. Studien zeigen, dass strukturierte oder teilstrukturierte Verfahren – etwa standardisierte Interviews kombiniert mit Arbeitsproben – deutlich zuverlässiger sind. Intuition kann diese Verfahren sinnvoll ergänzen – sie ersetzt jedoch keine methodisch abgesicherten Verfahren.
Auch zur Fehlerkultur nehmen die Autoren Stellung: In dysfunktionalen Organisationen werden Fehler vermieden und vertuscht oder Schuldige gesucht. In positiven Kulturen gelten Fehler dagegen als Lernquelle und Ausgangspunkt für Verbesserungen. Dieser Kontrast ist zwar nicht neu, wird hier jedoch praxisnah und anschaulich verdeutlicht.
Schließlich betonen die Autoren, dass Heuristiken auch im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz unverzichtbar bleiben. KI kann große Datenmengen analysieren und Muster erkennen, doch gerade in ungewissen Kontexten bieten menschliche Heuristiken Orientierung. Die Autoren plädieren daher für ein Zusammenspiel beider Ansätze: KI für datenintensive Analysen, Heuristiken für schnelle und kontextsensible Entscheidungen.
Fazit
Smart Management ist ein anregendes Lesevegnügen und regt nicht nur zu besseren Entscheidungen an, sondern vor allem zur Reflexion darüber, wie wir entscheiden. In einer Zeit wachsender Unsicherheit ist diese Meta-Perspektive besonders wertvoll. Die Stärke des Buches liegt in der Verbindung von wissenschaftlichen Konzepten mit praktischen Beispielen. Zugleich baut es auf dem Forschungsprogramm der fast-and-frugal heuristics auf – Entscheidungsregeln, die bewusst auf Einfachheit setzen und mit wenig Information oft erstaunlich treffsicher sind – und verdeutlicht, wie sich diese Ansätze konsequent auf Management- und Führungspraxis übertragen lassen.
Auch wenn manche Passagen – etwa zu Personalentscheidungen – empirisch noch eher schmal belegt sind, gelingt es den Autoren, komplexe Theorien in einen handlungsrelevanten Rahmen zu übersetzen. Damit richtet sich das Buch vor allem an Führungskräfte, Manager und Personalverantwortliche, die ihre Entscheidungsstrategien bewusst weiterentwickeln wollen.
Hilfreich ist zudem das umfangreiche Glossar mit über 50 Einträgen, das die wichtigsten Begriffe bündelt und das Buch auch als praktisches Nachschlagewerk nutzbar macht. Das Buch lädt insgesamt dazu ein darüber nachzudenken, wie man bessere Entscheidungen treffen kann.
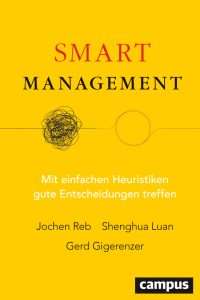 Jochen Reb, Shenghua Luan, Gerd Gigerenzer: Smart Management – Mit einfachen Heuristiken gute Entscheidungen treffen. Frankfurt: Campus Verlag, 304 Seiten, 49 Euro
Jochen Reb, Shenghua Luan, Gerd Gigerenzer: Smart Management – Mit einfachen Heuristiken gute Entscheidungen treffen. Frankfurt: Campus Verlag, 304 Seiten, 49 Euro
Head of People bei DocCheck AG


