Als der Psychologe und frühere Wissenschaftsjournalist der New York Times Daniel Goleman 1995 sein Buch Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ veröffentlichte, machte er den Begriff der emotionalen Intelligenz (EI) international bekannt. Seine These, dass emotionale Intelligenz für den privaten und beruflichen Erfolg bedeutsamer sei als kognitive Intelligenz, fand in der Öffentlichkeit und Ratgeberszene enorme Resonanz. Zugleich war die Kritik aus der Fachwelt vernichtend, da es sowohl theoretische Mängel gab als auch an empirisch belastbaren Studien fehlte, die diese weitreichenden Behauptungen stützen konnten. Gemeinsam mit dem Organisationspsychologen Cary Cherniss vertritt Golemann die Ansicht, dass heute – rund drei Jahrzehnte später – genügend Studien vorliegen, um Golemans Aussagen wissenschaftlich zu untermauern. Mit ihrem Buch möchten sie zeigen, wie emotionale Intelligenz helfen kann, persönliche Höchstleistungen zu erreichen.
Worum handelt es sich bei der emotionalen Intelligenz?
In der wissenschaftlich fundierten Psychologie bezeichnet emotionale Intelligenz die Fähigkeit, eigene und fremde Emotionen gezielt wahrzunehmen, zu verstehen, zu nutzen und zu regulieren, um Denken und Verhalten zu steuern. Dieses Verständnis basiert auf dem wissenschaftlich fundierten und in der Forschung am weitesten verbreiteten Vier-Zweige-Modell (Four-Branch Model) von Mayer und Salovey, das EI in vier Bereiche unterteilt:
- Wahrnehmung von Emotionen, etwa durch Mimik, Stimme oder Körpersprache
- Nutzung von Emotionen, um Denken, Problemlösen und Entscheidungen zu fördern
- Verstehen von Emotionen, einschließlich der Fähigkeit, emotionale Entwicklungen einzuordnen
- Regulation von Emotionen, um eigene Gefühle und die anderer konstruktiv zu beeinflussen
Goleman und Cherniss verstehen unter emotionaler Intelligenz nicht nur die Fähigkeit, Gefühle bei sich selbst und anderen präzise wahrzunehmen und einzuordnen. Ihr Konzept schließt auch die Kompetenz ein, sich selbst zu motivieren und Emotionen im Alltag sowie in Beziehungen konstruktiv zu steuern. Damit beschreiben sie emotionale Intelligenz als ein breites Bündel aus Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Motivation, Empathie und sozialem Geschick.
Darauf aufbauend erweitern die Autoren das Standardmodell und stellen verschiedene Schlüsselkompetenzen vor, von denen einige im Folgenden skizziert werden.
Beim Selbstbewusstsein geht es den Autoren beispielsweise um die emotionale Selbstwahrnehmung: Wie beeinflussen Emotionen unsere Wahrnehmung, unser Denken sowie Erinnerungen und Handlungsimpulse?
Im Bereich Selbstmanagement betonen sie die Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Dazu gehört, Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn sich Herausforderungen ändern, und flexibel zu reagieren. Vor allem das Gleichgewicht der eigenen Gefühle sei wichtig. Die Autoren betonen auch Feedback-Orientierung als Teil einer hohen Leistungsmotivation und sehen Anpassungsfähigkeit als notwendig, um möglichst optimal auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren.
Beim sozialen Bewusstsein legen die Autoren Wert auf Empathie. Sie unterscheiden dabei kognitive Empathie – also die Fähigkeit, zu antizipieren, wie das Gegenüber denkt, spricht und welche Perspektive es einnimmt – von emotionalem Einfühlungsvermögen, dem konkreten Spüren, wie sich die Person fühlt. Das hilft, Botschaften authentisch zu vermitteln und durch empathische Anteilnahme Beziehungen zu stärken. Beim Organisationsbewusstsein wird Empathie durch soziale Intelligenz ergänzt – bezogen auf Teams und Netzwerke im Unternehmen. In Belastungsphasen kann ein unterstützendes Arbeitsumfeld stabilisieren. Durch Einfühlungsvermögen können Mitmenschen leichter geführt, beeinflusst und inspiriert werden.
Im Bereich Beziehungsmanagement geht es darum, dass Beziehungen gedeihen können. Neben Selbstkontrolle und Empathie hilft es, einen kühlen Kopf zu bewahren und konstruktive Lösungen zu finden. Dazu gehört, Vertrauen aufzubauen, um in einen offenen Austausch zu treten.
Bereits an diesen Erläuterungen wird deutlich, dass das Verständnis von Goleman und Cherniss ein Potpourri aus Kompetenzen, Werten, Motiven, Verhalten und Persönlichkeitsmerkmalen darstellt – aus Sicht vieler Kritiker so breit, dass das Konzept empirisch kaum trennscharf überprüfbar ist und in seiner Unschärfe zu viele unterschiedliche Dinge vermischt, die alle so positiv klingen.
Empirische Evidenz und Kritik
Was beim Lesen auffällt, ist, dass die Autoren den Eindruck erwecken, die Wirksamkeit emotionaler Intelligenz für den Führungserfolg sei heute zweifelsfrei belegt. Sie erwähnen zahlreiche Studien, ohne jedoch die Höhe der Korrelationen oder den Anteil der erklärten Varianz einzuordnen.
Tatsächlich zeigen Metaanalysen, dass emotionale Intelligenz nach Kontrolle von Intelligenz und Persönlichkeit bei objektiven Leistungskriterien nur einen geringen zusätzlichen Beitrag erklärt – meist im Bereich von zwei bis vier Prozent Varianzaufklärung. Personen mit hoher emotionaler Intelligenz sind im Durchschnitt etwas zufriedener, zeigen mehr Commitment, empfinden Belastungen als weniger stressend und erzielen in sozialen Berufen tendenziell bessere Leistungen. Diese Effekte liegen durchgehend im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Daher ist es durchaus sinnvoll, emotionale Intelligenz ergänzend zu berücksichtigen, auch wenn sie empirisch kein zentraler Erfolgsfaktor für die Prognose beruflichen Erfolgs darstellt.
Ein besonders illustratives Beispiel für diese Überhöhung ist die plakative Aussage auf der Buchrückseite der deutschen Ausgabe, nach der fast 90 Prozent des Führungserfolgs auf emotionale Intelligenz zurückzuführen seien. Solche Zahlen entbehren jeder wissenschaftlichen Grundlage und widersprechen den empirischen Befunden fundamental.
Auch wenn diese Zahl so nicht explizit im Buch vorkommt, spiegelt sie dennoch die Grundhaltung der Autoren wider, wonach emotionale Intelligenz deutlich bedeutsamer sei als kognitive Intelligenz. Die Autoren betonen, dass Intelligenz für schulischen und akademischen Erfolg relevant sei, im Berufsleben aber an Bedeutung verliere. Diese Einschätzung ist jedoch verkürzt. Intelligenz bleibt über die gesamte Laufbahn hinweg ein stabiler Prädiktor für beruflichen Erfolg und erklärt etwa ein Viertel der Varianz. Die prognostische Relevanz wird durch weitere Faktoren wie Persönlichkeitsmerkmale – insbesondere Gewissenhaftigkeit – ergänzt, die etwa zehn Prozent Varianzaufklärung beitragen können. Zudem variiert die Bedeutung je nach Berufsfeld, abhängig vom Anteil an Interaktion mit anderen Menschen.
Einflussfaktoren in der Praxis
In dem breiten Verständnis der Autoren von EI verschwimmen verschiedene Faktoren, sodass zwischen Kompetenz, Persönlichkeit und kognitiver Fähigkeit kaum noch zu unterscheiden ist. Unstrittig ist, dass Empathie und zwischenmenschliche Beziehungen im beruflichen und privaten Umfeld wichtig sind. Aber das EI-Konzept im Sinne von Goleman muss seinen (zusätzlichen) Nutzen in der Eignungsdiagnostik oder in der Führungskräfte- und Organisationsentwicklung belegen können. Persönlichkeitsprofile mit geringer sozialer Kompetenz zeigen häufig eine niedrige Verträglichkeit und hohe emotionale Instabilität (Neurotizismus). Diese Merkmale werden durch die Big Five bereits erfasst. Neben Persönlichkeitsfaktoren wirken auch strukturelle Rahmenbedingungen und Karriereverläufe darauf ein, wie stark soziale Kompetenzen tatsächlich entwickelt und eingesetzt werden. Auch erlernte Verhaltensmuster können durch berufliche Rahmenbedingungen verstärkt werden. So führen dauerhaft hoher Druck und Ressourcen-Knappheit in Hochleistungsumfeldern oft dazu, dass Empathie und aktives Zuhören als verzichtbar gelten. Stattdessen rücken schnelle Ergebnisse in den Vordergrund, während soziale Kompetenzen eher delegitimiert werden.
Ein weiterer Faktor ist, dass Führungskräfte häufig aufgrund ihrer fachlichen Expertise befördert werden, nicht aber wegen ihrer Fähigkeit, tragfähige Beziehungen zu gestalten oder Konflikte konstruktiv zu moderieren. Vielen Führungskräften fehlen daher grundlegende Fertigkeiten wie Feedback, Beziehungsaufbau und Konfliktmanagement. Diese Kompetenzen sind jedoch grundsätzlich trainierbar. Dafür benötigt es aber kein eigenständiges Konstrukt.
Zukunft der emotionalen Intelligenz
Im abschließenden Kapitel werfen Goleman und Cherniss einen Blick in die Zukunft der emotionalen Intelligenz. Sie betonen, dass EI in einer zunehmend komplexen, digitalen und dynamischen Arbeitswelt essenziell ist, um optimale Leistungen zu erzielen und zugleich Wohlbefinden sowie Resilienz zu fördern. Aus ihrer Sicht ist emotionale Intelligenz eine Schlüsselkompetenz, die individuelle Exzellenz ermöglicht und zugleich die Grundlage für gesunde und leistungsfähige Organisationen schafft.
Auch auf Teamebene messen die Autoren emotionaler Intelligenz große Bedeutung bei. Sie verstehen sie hier nicht nur als individuelle Fähigkeit, sondern als Teil einer gemeinsamen Teamkultur, die psychologische Sicherheit und geteilte Werte fördert. So sollen konstruktive Zusammenarbeit und Vertrauen gestärkt werden. Im Bereich Diversity, Equity & Inclusion (DEI) verweisen sie auf die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität und empfehlen statt allgemeiner, aber meist wenig wirksamer DEI-Schulungen gezielte Mentoringprogramme für unterrepräsentierte Gruppen. Die Autoren gehen auch darauf ein, wie emotionale Intelligenz entwickelt werden kann. Voraussetzungen dafür sind motivierte Teilnehmende, regelmäßige Übung, Rückhalt durch Kolleginnen und Kollegen sowie Unterstützung durch Führungskräfte und Management.
Gesamtbewertung
Goleman und Cherniss liefern ein engagiertes Plädoyer für mehr emotionale Intelligenz im Beruf, betonen Praxisnähe und Kulturwandel und stellen emotionale Kompetenz als Schlüssel zu erfolgreicher Führung dar. Das Buch verspricht viel und vermittelt den Eindruck, emotionale Intelligenz sei als zentraler Erfolgsfaktor für das berufliche und private Leben umfassend empirisch belegt. Tatsächlich wird emotionale Intelligenz im Sinne der beiden Autoren als entscheidender Einflussfaktor inszeniert, obwohl die empirische Basis und praktische Relevanz für diesen Anspruch erheblich überhöht ist.
Damit bleibt sie deutlich hinter den großen Versprechungen zurück, die in populären Veröffentlichungen seit Jahren verbreitet und auch in diesem Buch selbstbewusst postuliert werden. Auch die Behauptung, emotionale Intelligenz sei wichtiger als allgemeine Intelligenz, ist in der Trainings- und Coaching-Szene zwar anschlussfähig, wissenschaftlich jedoch nicht haltbar. Gleichwohl kann emotionale Intelligenz die Zusammenarbeit fördern und Reflexionsprozesse anstoßen. Ebenso kann das Führungsleitbild einer wertschätzenden, selbstreflektierten und empathischen Haltung sinnvoll eingesetzt werden. Für Diagnostik oder Leistungsprognosen leisten diese Konzepte jedoch nur einen kleinen Beitrag, der nicht mit der Vorhersagekraft von Intelligenz oder Persönlichkeit vergleichbar ist.
Insgesamt ist es ein Buch, das man durchaus mit Gewinn lesen kann, sofern die Erwartungen an wissenschaftliche Fundierung und Prognosekraft für Erfolg nicht zu hoch sind. Die bekannten Probleme mit Golemans weit gefasster Definition emotionaler Intelligenz bleiben jedoch auch nach 30 Jahren bestehen.
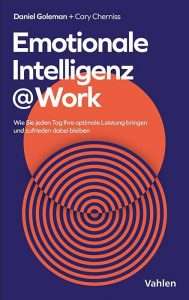 Daniel Goleman & Cary Cherniss: Emotionale Intelligenz @ Work: Auf dem Weg zur optimalen Leistung – als Führungskraft, im Team und in der gesamten Organisation. München: Verlag Franz Vahlen, 2025, 284 Seiten, 24,90 Euro
Daniel Goleman & Cary Cherniss: Emotionale Intelligenz @ Work: Auf dem Weg zur optimalen Leistung – als Führungskraft, im Team und in der gesamten Organisation. München: Verlag Franz Vahlen, 2025, 284 Seiten, 24,90 Euro
Head of People bei DocCheck AG


